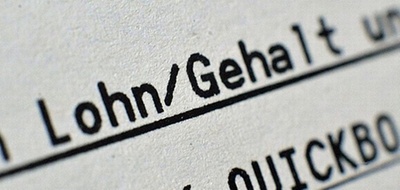Befristungen nach einem bestimmten Zweck des Arbeitsverhältnisses sind ebenfalls grundsätzlich zulässig, soweit sich die Dauer der Arbeitsleistung objektiv aus dem Zweck ergibt, z. B. Einstellung zur Pflege eines Schwerkranken bis zur Genesung oder zum Tod des Betroffenen.
Beide Vertragsparteien müssen sich darüber einig sein, dass die Dauer des Arbeitsverhältnisses von seinem Zweck abhängig sein soll. Die einseitig durch den Arbeitgeber geäußerte Zwecksetzung reicht nicht aus.
Bei Zweckbefristungen erfasst das Schriftformerfordernis auch die Angabe des Befristungszwecks.
Eine wirksame Zweckbefristung setzt voraus, dass der konkrete Zweck, mit dessen Erreichung das Arbeitsverhältnis enden soll, genau bezeichnet ist. Es muss zweifelsfrei feststellbar sein, bei Eintritt welchen Ereignisses das Arbeitsverhältnis enden soll.
Der konkrete Zweck muss deshalb in die Befristungsabrede aufgenommen werden!
Nach § 15 Abs. 2 TzBfG endet ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung.
Obwohl § 15 Abs. 2 TzBfG seinem Wortlaut zufolge eine "schriftliche Unterrichtung" durch den Arbeitgeber verlangt, ist nach der Rechtsprechung des BAG
die Einhaltung der Textform nach § 126b BGB ausreichend.
Zwar bestimmt § 126 BGB: "Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden." Nach der Rechtsprechung des BAG ist das Schriftformerfordernis des § 126 BGB – trotz dessen offenen Wortlauts – auf Rechtsgeschäfte beschränkt und nicht unmittelbar auf sog. rechtsgeschäftsähnliche Erklärungen anzuwenden. Die Unterrichtung der Beschäftigten über den Eintritt des Befristungszwecks ist eine solche einseitige rechtsgeschäftsähnliche Handlung. Die Unterrichtung dient der rechtzeitigen Information des Beschäftigten über den genauen Zeitpunkt des Eintritts der Zweckerreichung und somit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dem Formerfordernis des § 15 Abs. 2 TzBfG kommt Informations-, Klarstellungs- und Beweisfunktion zu. Um diesen mit dem Formerfordernis verfolgten Zweck zu erreichen, genügt es, wenn der Arbeitgeber entsprechend § 126b BGB die Textform einhält.
Das Arbeitsverhältnis ist befristet zur Vertretung des erkrankten Beschäftigten "X" bis zu dessen Rückkehr an den Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber teilt dem Beschäftigten in einem Brief mit, dass "X" am 28.2.2025 die Arbeit wieder aufnehmen wird, der Befristungszweck somit erreicht ist und das befristete Arbeitsverhältnis endet. Der Brief ist nicht unterschrieben, sondern enthält stattdessen den Zusatz "Ihre Personalverwaltung – Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig."
Nach dem Urteil des BAG aus dem Jahr 2018
genügt der Brief ohne eigenhändige Unterschrift den Anforderungen einer Unterrichtung des Beschäftigten nach § 15 Abs. 2 TzBfG. Das Arbeitsverhältnis endet im Beispiel mit Ablauf des 28.2.2025, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang des Briefs. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht Anspruch auf Entgelt.
Auch eine E-Mail oder ein Telefax genügen der Textform.
Wird dem Beschäftigten die Zweckerreichung und damit das Enddatum dagegen nur mündlich oder in keiner Weise mitgeteilt, so fehlt es an der nach § 15 Abs. 2 TzBfG notwendigen formentsprechenden Unterrichtung. Der befristete Vertrag läuft weiter, bis der Arbeitgeber die formwirksame Unterrichtung nachholt und die 2-Wochen-Frist abgelaufen ist.
Es kann angemessen sein, bei Zweckbefristungen eine Höchstdauer anzugeben, etwa dann, wenn das Erreichen des Befristungszwecks völlig offen ist.
"Das Arbeitsverhältnis endet mit der Rückkehr des erkrankten Arbeitnehmers … an seinen Arbeitsplatz, spätestens mit Ablauf des 31.12.2025."
Solche Doppelbefristungen sind nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit zulässig, da der Beschäftigte sich auf diese Weise darauf einstellen kann, dass das Arbeitsverhältnis spätestens zu dem genannten Termin endet.
Unter TVöD-Anwendung sollte die Höchstdauer sich bei länger laufenden Verträgen in jedem Fall an der Fünf-Jahres-Grenze, die § 30 Abs. 2 TVöD für befristete Verträge vorsieht, orientieren (vgl. unten Punkt 5.3).
Eine mögliche Unwirksamkeit der Zweckbefristung hat auf die Wirksamkeit einer mitvereinbarten Zeitbefristung keinen Einfluss, wenn für Letztere ein sachlicher Grund besteht.
Beispiele für Zweckbefristungen:
- Krankheitsvertretungen,
- aufgabenbezogene Aushilfen,
- Mitarbeit in Forschungsprojekten